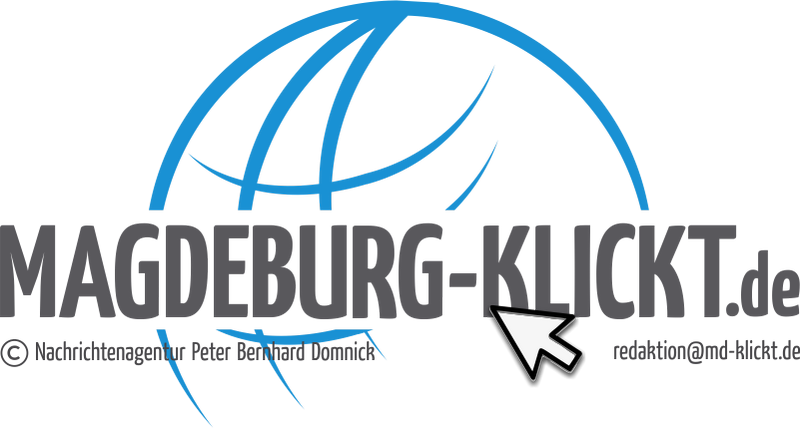Lutherstadt Eisleben. Salzwiesen sind im deutschen Binnenland vergleichsweise selten, bieten aber vielen angepassten Tier- und Pflanzenarten wie der Südlichen Binsenjungfer, seltenen Kleinschmetterlingen sowie der Strand-Aster und dem Queller wertvollen Lebensraum. Mit dem rund 448 Hektar großen Naturschutzgebiet „Salziger See“ bei Lutherstadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) verfügt Sachsen-Anhalt über eine bedeutende Salzwiesen-Fläche. Das Problem: Auf dem ehemaligen Seeboden hat sich durch fehlende Nutzung vielfach eine monotone Schilf-Fläche gebildet, welche die Salzwiesen überwächst und die Lebensräume der dort lebenden Arten gefährdet. Die Lösung: Eine 130 Hektar große Fläche soll mit einem festen, acht Kilometer langen Zaun umgeben und anschließend extensiv beweidet werden.
Dieses Projekt der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe wird durch das Umweltministerium mit 138.500 Euro gefördert; davon kommen 104.000 Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und 34.500 Euro vom Ministerium. Den Förderbescheid hat Umwelt-Staatssekretär Dr. Steffen Eichner heute vor Ort an Dr. Svenja Sammler von der NABU-Stiftung überreicht; sie betreut die Stiftungsflächen in Sachsen-Anhalt, zu denen auch das Projektgebiet am Salzigen See gehört. Der Zaun soll bis Oktober 2025 fertig sein und ab 2026 die regelmäßige Beweidung von verschilftem Feuchtgrünland, Salzwiesen-Entwicklungsflächen und angrenzenden Trockenrasenhängen ermöglichen.
Eichner betonte: „In vielen Regionen Sachsen-Anhalts stehen wir vor der Herausforderung, dass unter Naturschutz stehende Flächen durch fehlende Nutzung verbuschen oder verschilfen. Dadurch sind geschützte Lebensraumtypen und die dort heimischen Arten gefährdet. Deshalb unterstützen wir verstärkt Investitionen zum Erhalt dieser wertvollen Flächen wie hier am Salzigen See. Ich freue mich, dass wir auch dank der EU-Förderung das Projekt der NABU-Stiftung ermöglichen können.“
Dr. Svenja Sammler unterstrich: „Wir freuen uns, die Salzwiesen durch die Beweidung wieder zum Leben zu erwecken und gleichzeitig Dynamik und Struktur und damit mehr Artenvielfalt in die Schilfbestände zu bekommen.“ Martin Schulze von NABU-Landesverband Sachsen-Anhalt ergänzte, dass der Weidezaun erst der Anfang eines zielgerichteten Managements sein könne. Unbedingt mitgedacht werden müsse eine verbesserte Wasserführung der Röhrichte und Seen sowie ein Prädatorenmanagement. Erst dies zusammen würde dem Anspruch des FFH- und Vogelschutzgebietes gerecht werden. Der Zaun biete jedoch die perfekte Grundlage, zukünftig die im Gebiet vorhandenen Prädatoren zu reduzieren.
Anlässlich der Förderbescheid-Übergabe waren heute zudem Vertreterinnen und Vertreter von Landesverwaltungsamt, Hochschule Anhalt, Landesamt für Umweltschutz sowie Landkreis Mansfeld-Südharz zum Erfahrungsaustausch vor Ort. Mit dabei waren auch die Bio-Landwirte Ute und Volker Stens, die einen großen Teil der NABU-Stiftungsflächen am Salzigen See bewirtschaften und künftig die Beweidung der rund 130 Hektar großen Projektfläche übernehmen werden.
Bilanz zur EU-Naturschutzförderung
In der auslaufenden EU-Strukturfondsperiode sind in Sachsen-Anhalt aus dem ELER rund 27 Millionen Euro für 116 Naturschutzprojekte bewilligt worden; hinzu kam je eine 25-prozentige Kofinanzierung durch das Umweltministerium, in Höhe von insgesamt rund 9 Millionen Euro. Weitere 12 Projekte mit einem Gesamtumfang von rund 3,6 Millionen Euro wurden aus dem EU-Fonds zur Unterstützung des Wiederaufbaus nach der Corona-Pandemie zu 100 Prozent von der EU finanziert. In der aktuellen EU-Förderperiode 2023-2027 stehen für die Förderung von Naturschutzprojekten insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung, davon 80 Prozent aus dem ELER (16 Millionen Euro) und 20 Prozent Kofinanzierung durch das Umweltministerium (4 Millionen Euro). Ein erster Förderaufruf für Projekte mit einer Laufzeit bis maximal 2029 soll noch im April 2025 erfolgen.
Hintergrund:
Der Salzige See gehört geologisch zum Teutschenthaler Sattel und ist durch Auslaugung von salzhaltigen Gesteinen im Untergrund entstanden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der See trockengelegt und der Wasserstand über ein Pumpsystem reguliert, um Wassereinbrüche im nahegelegenen Kupferschieferbergbau zu verhindern. Nach Einstellung des Bergbaus kam es trotz Pumpenbetriebes zur Vernässung von Teilflächen des ehemaligen Seebodens; so entstanden die heutigen Flachgewässer mit ausgeprägten Schilfröhrichten, Salz- bzw. Feuchtwiesen und gleichzeitig wertvollen Trockenlebensräumen auf den ehemaligen Uferhangkanten des Salzigen Sees. Die Feuchtgebiete des Salzigen Sees gehören zu den überregional bedeutsamen Brut- und Rastgebieten, u.a. für Große Rohrdommel, Flussregenpfeifer oder Rohrweihe. Zudem haben seltene und bedrohte Libellen, Lurche, Heuschreckenarten und Kleinsäuger ihren Lebensraum im Naturschutzgebiet „Salziger See“.
Quelle: Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt am 02. April 2025
Foto: Salziger See und Salzatal © F. Meyer